OWEP 1/2018: Weichenstellungen in Europa
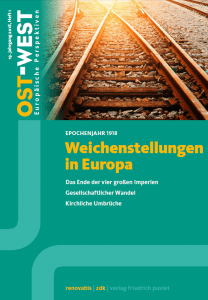
1918, vor 100 Jahren, endete der Erste Weltkrieg, den viele Historiker als „Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts“ bezeichnen. Diese pointierte Formulierung umschreibt, was den damals lebenden Menschen in Europa nur zu klar war, heute aber oft vergessen wird: Seit Herbst 1918 schwiegen zwar die Waffen zwischen der Entente und den Mittelmächten, und an die Stelle des Kriegs trat die Diplomatie, die zu den Friedensschlüssen der kommenden Jahre führte; vielerorts gingen die Kämpfe in Europa jedoch weiter, teils zwischen den Staaten, teils als Bürgerkrieg. Zugleich waren die folgenden Jahre trotz der materiellen und geistigen Verwüstungen, die der Weltkrieg hinterlassen hatte, eine Zeit des Aufbruchs, der kulturellen und wissenschaftlichen Blüte, die unter dem Schlagwort „Goldene zwanziger Jahre“ die breiten Massen allerdings kaum erreichte und letztlich nur von kurzer Dauer war.
„Weichenstellungen in Europa“ lautet der Titel, den die Redaktion der ersten Ausgabe des Jahres 2018 gegeben hat. Damit soll deutlich werden, dass die politisch-gesellschaftliche Gestalt Europas, wie sie sich heute darstellt, auf die Veränderungen nach Ende des Ersten Weltkriegs zurückgeht. Vier große Monarchien, das Deutsche Kaiserreich, die Doppelmonarchie Österreich-Ungarn, das Osmanische Reich und – bereits 1917 – das Russische Zarenreich brachen zusammen, vor allem in Mittel-, Ost- und Südosteuropa entstanden neue Staaten mit z. T. strittigen Grenzen, die den Keim für neue, oft bis in die Gegenwart reichende Konflikte legten. Es ist leider nicht zu leugnen: Viele Probleme der heutigen Europäischen Union hängen mit kaum oder gar nicht gelösten Krisensituationen jener Umbruchsphase zusammen, weshalb es wichtig ist, sich mit dieser Zeit etwas näher zu befassen. Die Beiträge des aktuellen Heftes wollen dazu ein wenig beitragen.
Die beiden ersten Beiträge des Heftes führen die Leserinnen und Leser in die Geschichte des Ersten Weltkriegs und ziehen daraus Linien zur heutigen Lage Europas. Vorgeschaltet ist eine Skizze, die die politische Landkarte Europas um 1913 und nach 1920 zeigt. Mit dem Aufsatz „1918 – Eine Welt im Umbruch“ vermittelt der an der Universität Jena tätige Historiker Dr. Jochen Böhler in knappen Strichen einen Überblick zu Vorgeschichte, Verlauf und Folgen des Ersten Weltkriegs speziell für Mittel-, Ost- und Südosteuropa. Direkt daran an schließen die Überlegungen des emeritierten, zuletzt an der Universität Wien lehrenden Politikwissenschaftlers Prof. Dr. Dieter Segert. Im Mittelpunkt seines Beitrags steht die weitere Entwicklung der vier großen im Gefolge des Ersten Weltkriegs untergegangenen Monarchien (Deutsches Reich, Österreich-Ungarn, Osmanisches Reich und Russisches Reich), wobei er deren Weg bis in die Gegenwart verfolgt und unter dem Leitgedanken „Entwicklung zur Demokratie“ analysiert.
Die folgenden drei Texte des Heftes richten den Blick auf drei Länder, deren Geschichte vor einhundert Jahren eine unerwartete Wendung nahm. Dr. Kimberly Lamay Licursi, Dozentin für Geschichte der USA am Siena College in Loudonville, NY, schildert das Eingreifen der USA in den Ersten Weltkrieg, das sich nicht nur auf dem militärischen Sektor auswirkte, sondern auch wirtschaftliche und kulturelle Folgen hatte und den Aufstieg der USA zur Weltmacht des 20. Jahrhunderts markierte. Österreich hingegen war einer der Hauptverlierer des „Großen Krieges“ und schrumpfte nach dem Zerfall der Donaumonarchie zu einem Kleinstaat, der unmittelbar nach dem Krieg, wie der Beitrag des an der Universität Wien lehrenden Historikers Prof. Dr. Peter Becker eindringlich aufzeigt, wirtschaftlich und finanziell am Boden lag. Nur durch massive Anstrengungen im Innern und ausländische Unterstützung, teilweise auch aus ehemaligen Kronländern, konnte sich das Land in den zwanziger Jahren erholen. Wieder eine andere Konstellation steht im Mittelpunkt des Essays von Dr. Fernando Zamola, Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Südosteuropäische Geschichte an der Humboldt-Universität zu Berlin. Er blickt auf die südslawischen Gebiete Österreich-Ungarns und zeichnet ihren Weg zur Vereinigung mit dem Königreich Serbien und damit zur Bildung Jugoslawiens nach dem Ersten Weltkrieg nach, der – so seine These – durchaus nicht zwangsläufig war; vielmehr war das neue Staatswesen von Anfang an mit Problemen belastet, die letztlich zu seinem Zerfall in den neunziger Jahren des 20. Jahrhunderts führten.
Wie schon einführend bemerkt, waren die Jahre vor und nach dem Ersten Weltkrieg von zahlreichen Innovationen in Wissenschaft und Technik geprägt; teilweise wirkte der Krieg regelrecht als Katalysator. Genau diese Veränderungen stehen im Mittelpunkt des Beitrags von Dr. Thomas N. Kirstein und Alwin Cubasch, beide tätig im Bereich Kultur- und Wissensgeschichte der Technischen Universität bzw. der Humboldt-Universität zu Berlin. Anhand der Bereiche Mobilität, Militärwesen, Produktion von Kunststoffen und Computern zeigen sie, wie technische Entwicklungen jener Jahre das Leben der Menschen im 20. Jahrhundert verändert haben.
Einem ganz anderen Bereich, in dem es nach dem Ersten Weltkrieg zu einem gesellschaftlichen Aufbruch kam, widmet sich Dr. Kerstin Wolff, Mitarbeiterin des Forschungsinstituts und Dokumentationszentrums AddF – Archiv der der deutschen Frauenbewegung in Kassel. Sie zeichnet den langen Weg zum Frauenwahlrecht in Deutschland seit dem frühen 19. Jahrhundert nach, das erst mit Ende des Deutschen Kaiserreichs und dem Übergang zur Weimarer Republik eingeführt wurde. Von einer wirklichen Gleichberechtigung von Frauen und Männern konnte allerdings noch lange keine Rede sein, das Frauenwahlrecht war letztlich nur ein Etappenziel.
Die beiden abschließenden Beiträge, verfasst mit Mitgliedern der OWEP-Redaktion, lenken den Blick auf gesellschaftlich relevante Größen, die ebenfalls vom Epochenwandel berührt wurden. Prof. Dr. Thomas Bremer untersucht die Veränderungen der Kirchen im 20. Jahrhundert. So öffnete z. B. der Wegfall des Summepiskopats in den evangelisch geprägten Ländern des Deutschen Reiches den Weg für neue Strukturen; andere Veränderungen bestimmten die Entwicklung der römisch-katholischen Kirche und der Orthodoxie, wobei letztere in der Sowjetunion seit den zwanziger Jahren aus der Position der Staatskirche in die Lage einer unterdrückten Minderheit geriet. Prof. Dr. Michael Albus befasst sich mit dem Journalismus im frühen 20. Jahrhundert, der damals zu seinen bis heute gültigen Ausdrucksformen gefunden hat. Im Mittelpunkt seines Essays steht eine bedeutendsten Persönlichkeiten jener Jahre, der „rasende Reporter“ Egon Erwin Kisch.
Das ausführliche Inhaltsverzeichnis und ein Beitrag im Volltext finden sich unter www.owep.de. Das Heft kann für € 6,50 (zzgl. Versandkosten) unter www.owep.de bestellt werden.
„Weichenstellungen in Europa“ lautet der Titel, den die Redaktion der ersten Ausgabe des Jahres 2018 gegeben hat. Damit soll deutlich werden, dass die politisch-gesellschaftliche Gestalt Europas, wie sie sich heute darstellt, auf die Veränderungen nach Ende des Ersten Weltkriegs zurückgeht. Vier große Monarchien, das Deutsche Kaiserreich, die Doppelmonarchie Österreich-Ungarn, das Osmanische Reich und – bereits 1917 – das Russische Zarenreich brachen zusammen, vor allem in Mittel-, Ost- und Südosteuropa entstanden neue Staaten mit z. T. strittigen Grenzen, die den Keim für neue, oft bis in die Gegenwart reichende Konflikte legten. Es ist leider nicht zu leugnen: Viele Probleme der heutigen Europäischen Union hängen mit kaum oder gar nicht gelösten Krisensituationen jener Umbruchsphase zusammen, weshalb es wichtig ist, sich mit dieser Zeit etwas näher zu befassen. Die Beiträge des aktuellen Heftes wollen dazu ein wenig beitragen.
Die beiden ersten Beiträge des Heftes führen die Leserinnen und Leser in die Geschichte des Ersten Weltkriegs und ziehen daraus Linien zur heutigen Lage Europas. Vorgeschaltet ist eine Skizze, die die politische Landkarte Europas um 1913 und nach 1920 zeigt. Mit dem Aufsatz „1918 – Eine Welt im Umbruch“ vermittelt der an der Universität Jena tätige Historiker Dr. Jochen Böhler in knappen Strichen einen Überblick zu Vorgeschichte, Verlauf und Folgen des Ersten Weltkriegs speziell für Mittel-, Ost- und Südosteuropa. Direkt daran an schließen die Überlegungen des emeritierten, zuletzt an der Universität Wien lehrenden Politikwissenschaftlers Prof. Dr. Dieter Segert. Im Mittelpunkt seines Beitrags steht die weitere Entwicklung der vier großen im Gefolge des Ersten Weltkriegs untergegangenen Monarchien (Deutsches Reich, Österreich-Ungarn, Osmanisches Reich und Russisches Reich), wobei er deren Weg bis in die Gegenwart verfolgt und unter dem Leitgedanken „Entwicklung zur Demokratie“ analysiert.
Die folgenden drei Texte des Heftes richten den Blick auf drei Länder, deren Geschichte vor einhundert Jahren eine unerwartete Wendung nahm. Dr. Kimberly Lamay Licursi, Dozentin für Geschichte der USA am Siena College in Loudonville, NY, schildert das Eingreifen der USA in den Ersten Weltkrieg, das sich nicht nur auf dem militärischen Sektor auswirkte, sondern auch wirtschaftliche und kulturelle Folgen hatte und den Aufstieg der USA zur Weltmacht des 20. Jahrhunderts markierte. Österreich hingegen war einer der Hauptverlierer des „Großen Krieges“ und schrumpfte nach dem Zerfall der Donaumonarchie zu einem Kleinstaat, der unmittelbar nach dem Krieg, wie der Beitrag des an der Universität Wien lehrenden Historikers Prof. Dr. Peter Becker eindringlich aufzeigt, wirtschaftlich und finanziell am Boden lag. Nur durch massive Anstrengungen im Innern und ausländische Unterstützung, teilweise auch aus ehemaligen Kronländern, konnte sich das Land in den zwanziger Jahren erholen. Wieder eine andere Konstellation steht im Mittelpunkt des Essays von Dr. Fernando Zamola, Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Südosteuropäische Geschichte an der Humboldt-Universität zu Berlin. Er blickt auf die südslawischen Gebiete Österreich-Ungarns und zeichnet ihren Weg zur Vereinigung mit dem Königreich Serbien und damit zur Bildung Jugoslawiens nach dem Ersten Weltkrieg nach, der – so seine These – durchaus nicht zwangsläufig war; vielmehr war das neue Staatswesen von Anfang an mit Problemen belastet, die letztlich zu seinem Zerfall in den neunziger Jahren des 20. Jahrhunderts führten.
Wie schon einführend bemerkt, waren die Jahre vor und nach dem Ersten Weltkrieg von zahlreichen Innovationen in Wissenschaft und Technik geprägt; teilweise wirkte der Krieg regelrecht als Katalysator. Genau diese Veränderungen stehen im Mittelpunkt des Beitrags von Dr. Thomas N. Kirstein und Alwin Cubasch, beide tätig im Bereich Kultur- und Wissensgeschichte der Technischen Universität bzw. der Humboldt-Universität zu Berlin. Anhand der Bereiche Mobilität, Militärwesen, Produktion von Kunststoffen und Computern zeigen sie, wie technische Entwicklungen jener Jahre das Leben der Menschen im 20. Jahrhundert verändert haben.
Einem ganz anderen Bereich, in dem es nach dem Ersten Weltkrieg zu einem gesellschaftlichen Aufbruch kam, widmet sich Dr. Kerstin Wolff, Mitarbeiterin des Forschungsinstituts und Dokumentationszentrums AddF – Archiv der der deutschen Frauenbewegung in Kassel. Sie zeichnet den langen Weg zum Frauenwahlrecht in Deutschland seit dem frühen 19. Jahrhundert nach, das erst mit Ende des Deutschen Kaiserreichs und dem Übergang zur Weimarer Republik eingeführt wurde. Von einer wirklichen Gleichberechtigung von Frauen und Männern konnte allerdings noch lange keine Rede sein, das Frauenwahlrecht war letztlich nur ein Etappenziel.
Die beiden abschließenden Beiträge, verfasst mit Mitgliedern der OWEP-Redaktion, lenken den Blick auf gesellschaftlich relevante Größen, die ebenfalls vom Epochenwandel berührt wurden. Prof. Dr. Thomas Bremer untersucht die Veränderungen der Kirchen im 20. Jahrhundert. So öffnete z. B. der Wegfall des Summepiskopats in den evangelisch geprägten Ländern des Deutschen Reiches den Weg für neue Strukturen; andere Veränderungen bestimmten die Entwicklung der römisch-katholischen Kirche und der Orthodoxie, wobei letztere in der Sowjetunion seit den zwanziger Jahren aus der Position der Staatskirche in die Lage einer unterdrückten Minderheit geriet. Prof. Dr. Michael Albus befasst sich mit dem Journalismus im frühen 20. Jahrhundert, der damals zu seinen bis heute gültigen Ausdrucksformen gefunden hat. Im Mittelpunkt seines Essays steht eine bedeutendsten Persönlichkeiten jener Jahre, der „rasende Reporter“ Egon Erwin Kisch.
Das ausführliche Inhaltsverzeichnis und ein Beitrag im Volltext finden sich unter www.owep.de. Das Heft kann für € 6,50 (zzgl. Versandkosten) unter www.owep.de bestellt werden.
